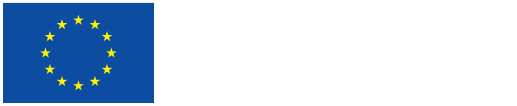Bilder extremer Gewalt entstehen und zirkulieren in aktuellen Konflikten in großer Zahl. In der Öffentlichkeit werden sie dennoch selten gezeigt. Das gilt für Gewaltexzesse im sogenannten Islamischen Staat ebenso wie für das Hamas-Pogrom vom 7. Oktober 2023, für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine und für andere Formen von Gewaltausübung in militärischen und politischen Konflikten. Es gilt aber auch für jene Bilder, die bis heute zurecht als zentraler Bezugspunkt und Maßstab für die Darstellung von Gewaltverbrechen einstehen: Film- und Fotoaufnahmen von der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager und von der Entdeckung anderer Orte nationalsozialistischer Massenverbrechen. Während sie als Referenzen in Spielfilmen und Dokumentarfilmen, in Videospielen und anderen Medien in vielfacher Weise präsent sind, haben Gedenkstätten und andere Institutionen in der Vermittlungsarbeit zunehmend Scheu, die verfügbaren Bilder zu zeigen. Viele Bilder lagen bis vor kurzem weitgehend ungenutzt in Archiven. Das vom Ludwig Boltzmann Institute for Digital History gemeinsam mit dem Österreichischen Filmmuseum koordinierte EU-Projekt “Visual History of the Holocaust” gibt Antworten auf die Frage, ob und wenn ja, in welcher Form man diese Atrocity Pictures zeigen soll.
18:30 – Visual History of the Holocaust
Michael Loebenstein, Ingo Zechner und Tobias Ebbrecht-Hartmann präsentieren die Online-Plattform und geben Einblicke in die Hintergründe zu ihrer Entstehung.
20:30 – Filmvorführung von Idi i smotri (Komm und sieh)
Elem Klimov, SU 1985
Drehbuch: Elem Klimov, Ales Adamovich; Kamera: Aleksey Rodionov; Schnitt: Valeriya Belova; Musik: Oleg Yanchenko; Darsteller*innen: Aleksei Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevičius. 35mm, Farbe, 142 min. Russisch mit dt. UT
Der ultimative Partisanenfilm und ein geradezu biblischer Vergleich der nationalsozialistischen Gräuel mit dem Schrecken der Apokalyptischen Reiter, der als Inspiration für den Titel diente. Bilder des Todes und der Hölle wachzurufen, das war die Absicht von Elem Klimov, der als Kind in Stalingrad die Brutalität des Krieges erlebte, und seines Koautors Ales Adamovich, der als Partisan in Weißrussland kämpfte und Zeuge der systematischen Vernichtung wurde. Idi i smotri sollte anlässlich des 40. Jahrestages des “Großen Sieges” die Welt an den faschistischen Völkermord in Weißrussland erinnern, der über eine Million Menschenleben forderte. Qualvoll, erschütternd, instinktiv, hyperrealistisch und dennoch lyrisch zugleich. Die Höllenfahrt aus der Sicht eines jungen weißrussischen Partisanen wurde als einer der größten Antikriegsfilme aller Zeiten berühmt.